Teleskope
- Manu
- Beiträge: 25835
- Registriert: Di 25. Apr 2017, 14:13
- Wohnort: Schermbeck
- Kontaktdaten:
Teleskope
Teleskop "GLAST"
Das Funkeln der Sterne am Nachthimmel zeigt nur einen kleinen Teil des Universums. So sind selbst die gewaltigsten Explosionen im Weltall für das bloße Auge meist nicht zu erkennen. Solche und andere verborgene kosmische Katastrophen wird künftig das Weltraumteleskop "GLAST" der US-Raumfahrtbehörde NASA erforschen. Es soll nach mehreren Startverschiebungen wegen Problemen mit der Raketenbatterie am 11. Juni vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida abheben. Von dem fast 700 Millionen US-Dollar teuren Instrument erwarten Astronomen einen der bislang tiefsten Blicke ins All.
Unsichtbares Licht aus Gammastrahlen
Das "GLAST" (Gamma-ray Large Area Space Telescope) beobachtet den Himmel im Bereich der energiereichen kosmischen Gammastrahlung. Dieses für das bloße Auge unsichtbare Licht stammt meist aus exotischen Quellen: Sternleichen, die ihre Umgebung mit der intensiven Strahlung rösten, gigantische Schwarze Löcher, die reihenweise ganze Sternsysteme verschlingen, und möglicherweise auch von der immer noch rätselhaften Dunklen Materie. Die ist zwar rund vier Mal häufiger als gewöhnliche Materie, aus der Sterne, Planeten und auch Menschen bestehen. Ihre Beschaffenheit ist jedoch völlig unbekannt. Außer über ihre Schwerkraft könnte sie sich jedoch auch über Gammastrahlung bemerkbar machen, wenn zwei ihrer Partikel miteinander reagieren und zerstrahlen.
Spannung vor dem Start
"Mit GLAST werden wir diese Phänomene sehr viel empfindlicher untersuchen können", sagt Roland Diehl vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München, das als einzige deutsche Einrichtung an dem Teleskop beteiligt ist. Die Garchinger Gruppe blickt mit Anspannung auf den Start der Mission.
"Abschiedsfeuerwerk" ferner Riesensonnen
Die Erdatmosphäre schützt Menschen, Tiere und Pflanzen vor der kosmischen Strahlung. Auf der Erde sind nur die Folgeteilchen nachweisbar, die durch das unentwegte Bombardement der Strahlung entsteht. Ein Teleskop, das kosmische Gammastrahlung direkt untersuchen will, muss deshalb außerhalb der Atmosphäre im All stationiert werden. Das deutsche Max-Planck-Institut hat den Sensor für Gammastrahlenblitze (Gamma Ray Bursts) auf dem Weltraumteleskop entwickelt. Die meisten dieser Blitze sind nach heutigem Wissen gewissermaßen das "Abschiedsfeuerwerk" ferner Riesensonnen, die am Ende ihrer Existenz in einer spektakulären Explosion zu einem Schwarzen Loch zusammenstürzen.
Heller als Supernova-Explosionen
"Ein einzelner Gammastrahlenblitz kann in wenigen Sekunden dieselbe Energie freisetzen, die unsere Sonne in ihren gesamten zehn Milliarden Jahren Lebenszeit abstrahlt", erläutert NASA-Forscher Neil Gehrels vom Goddard Space Flight Center in Greenbelt im US-Staat Maryland. Die Ausbrüche sind damit noch heller als Supernova-Explosionen und die extrem leuchtkräftigen, weit entfernten aktiven Galaxien namens Quasare, die sonst als hellste Objekte im All gelten, wie Diehl erläutert. Sie sind aus noch größerer Entfernung zu sehen und damit aus einer noch früheren Vergangenheit - von einem zwölf Milliarden Lichtjahre entfernten Objekt benötigt das Licht zwölf Milliarden Jahre zur Erde. "Die Blitze können uns eine Epoche des Universums erhellen, in der sich die ersten Sterne gebildet haben", betont Diehl.
"Archäologie an Schwarzen Löchern"
Insgesamt erwarten die Astronomen von der auf mindestens fünf Jahre angelegten "GLAST"-Mission die Entdeckung tausender neuer Gammastrahlen-Quellen, hauptsächlich sogenannter Blazare. Dabei handelt es sich nach der aktuellen Theorie um weit entfernte Galaxien, in deren Zentrum sich ein monströses Schwarzes Loch Materie einverleibt und dabei intensive Gammastrahlung produziert. Die Strahlung beleuchtet damit die energiereiche Vergangenheit des Universums, wie Charles Dermer vom US-Marineforschungslabor in Washington erläutert. Der "GLAST"-Forscher spricht daher auch von einer "Archäologie an Schwarzen Löchern".
Das Funkeln der Sterne am Nachthimmel zeigt nur einen kleinen Teil des Universums. So sind selbst die gewaltigsten Explosionen im Weltall für das bloße Auge meist nicht zu erkennen. Solche und andere verborgene kosmische Katastrophen wird künftig das Weltraumteleskop "GLAST" der US-Raumfahrtbehörde NASA erforschen. Es soll nach mehreren Startverschiebungen wegen Problemen mit der Raketenbatterie am 11. Juni vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida abheben. Von dem fast 700 Millionen US-Dollar teuren Instrument erwarten Astronomen einen der bislang tiefsten Blicke ins All.
Unsichtbares Licht aus Gammastrahlen
Das "GLAST" (Gamma-ray Large Area Space Telescope) beobachtet den Himmel im Bereich der energiereichen kosmischen Gammastrahlung. Dieses für das bloße Auge unsichtbare Licht stammt meist aus exotischen Quellen: Sternleichen, die ihre Umgebung mit der intensiven Strahlung rösten, gigantische Schwarze Löcher, die reihenweise ganze Sternsysteme verschlingen, und möglicherweise auch von der immer noch rätselhaften Dunklen Materie. Die ist zwar rund vier Mal häufiger als gewöhnliche Materie, aus der Sterne, Planeten und auch Menschen bestehen. Ihre Beschaffenheit ist jedoch völlig unbekannt. Außer über ihre Schwerkraft könnte sie sich jedoch auch über Gammastrahlung bemerkbar machen, wenn zwei ihrer Partikel miteinander reagieren und zerstrahlen.
Spannung vor dem Start
"Mit GLAST werden wir diese Phänomene sehr viel empfindlicher untersuchen können", sagt Roland Diehl vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München, das als einzige deutsche Einrichtung an dem Teleskop beteiligt ist. Die Garchinger Gruppe blickt mit Anspannung auf den Start der Mission.
"Abschiedsfeuerwerk" ferner Riesensonnen
Die Erdatmosphäre schützt Menschen, Tiere und Pflanzen vor der kosmischen Strahlung. Auf der Erde sind nur die Folgeteilchen nachweisbar, die durch das unentwegte Bombardement der Strahlung entsteht. Ein Teleskop, das kosmische Gammastrahlung direkt untersuchen will, muss deshalb außerhalb der Atmosphäre im All stationiert werden. Das deutsche Max-Planck-Institut hat den Sensor für Gammastrahlenblitze (Gamma Ray Bursts) auf dem Weltraumteleskop entwickelt. Die meisten dieser Blitze sind nach heutigem Wissen gewissermaßen das "Abschiedsfeuerwerk" ferner Riesensonnen, die am Ende ihrer Existenz in einer spektakulären Explosion zu einem Schwarzen Loch zusammenstürzen.
Heller als Supernova-Explosionen
"Ein einzelner Gammastrahlenblitz kann in wenigen Sekunden dieselbe Energie freisetzen, die unsere Sonne in ihren gesamten zehn Milliarden Jahren Lebenszeit abstrahlt", erläutert NASA-Forscher Neil Gehrels vom Goddard Space Flight Center in Greenbelt im US-Staat Maryland. Die Ausbrüche sind damit noch heller als Supernova-Explosionen und die extrem leuchtkräftigen, weit entfernten aktiven Galaxien namens Quasare, die sonst als hellste Objekte im All gelten, wie Diehl erläutert. Sie sind aus noch größerer Entfernung zu sehen und damit aus einer noch früheren Vergangenheit - von einem zwölf Milliarden Lichtjahre entfernten Objekt benötigt das Licht zwölf Milliarden Jahre zur Erde. "Die Blitze können uns eine Epoche des Universums erhellen, in der sich die ersten Sterne gebildet haben", betont Diehl.
"Archäologie an Schwarzen Löchern"
Insgesamt erwarten die Astronomen von der auf mindestens fünf Jahre angelegten "GLAST"-Mission die Entdeckung tausender neuer Gammastrahlen-Quellen, hauptsächlich sogenannter Blazare. Dabei handelt es sich nach der aktuellen Theorie um weit entfernte Galaxien, in deren Zentrum sich ein monströses Schwarzes Loch Materie einverleibt und dabei intensive Gammastrahlung produziert. Die Strahlung beleuchtet damit die energiereiche Vergangenheit des Universums, wie Charles Dermer vom US-Marineforschungslabor in Washington erläutert. Der "GLAST"-Forscher spricht daher auch von einer "Archäologie an Schwarzen Löchern".
Das Leben besteht nicht aus den Momenten, in denen wir atmen,
sondern aus denen, die uns den Atem rauben
Aus "Hitch- der Date Doctor"



sondern aus denen, die uns den Atem rauben
Aus "Hitch- der Date Doctor"
- Manu
- Beiträge: 25835
- Registriert: Di 25. Apr 2017, 14:13
- Wohnort: Schermbeck
- Kontaktdaten:
"Fermi"-Weltraumteleskop ("GLAST") der NASA ist in Betrieb gegangen
Das im Juni diesen Jahres ins Weltall gebrachte "Fermi"-Weltraumteleskop ("GLAST") der NASA (ShortNews berichtete) ist jetzt in Betrieb gegangen. Das Teleskop hat sein erstes Bild per Funk zur Erde übermittelt.
Das etwa 700 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 450 Millionen Euro) teurere Weltraumteleskop trug beim Start in den Weltraum noch den Namen "GLAST" (Gamma-Ray Large Area Space Telescope). Zur Erinnerung an den US-Kernphysiker und Nobelpreisträger Enrico Fermi (1901-1954) taufte es man dann um.
"Fermi" macht Fotoaufnahmen im Bereich der Gammastrahlung. Die Wissenschaftler erhoffen sich vom Teleskop viele bisher unbekannte Quellen kosmischer Gammastrahlung. Für Deutschland ist lediglich das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (Garching) an dem fünfjährigen Projekt beteiligt.
Das etwa 700 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 450 Millionen Euro) teurere Weltraumteleskop trug beim Start in den Weltraum noch den Namen "GLAST" (Gamma-Ray Large Area Space Telescope). Zur Erinnerung an den US-Kernphysiker und Nobelpreisträger Enrico Fermi (1901-1954) taufte es man dann um.
"Fermi" macht Fotoaufnahmen im Bereich der Gammastrahlung. Die Wissenschaftler erhoffen sich vom Teleskop viele bisher unbekannte Quellen kosmischer Gammastrahlung. Für Deutschland ist lediglich das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (Garching) an dem fünfjährigen Projekt beteiligt.
Das Leben besteht nicht aus den Momenten, in denen wir atmen,
sondern aus denen, die uns den Atem rauben
Aus "Hitch- der Date Doctor"



sondern aus denen, die uns den Atem rauben
Aus "Hitch- der Date Doctor"
- Manu
- Beiträge: 25835
- Registriert: Di 25. Apr 2017, 14:13
- Wohnort: Schermbeck
- Kontaktdaten:
Neues Weltraumteleskop sucht dunkle Objekte
Pasadena/ USA - Mit dem neuen unbemannten Weltraumteleskop "Wide-Field Infrared Survey Explorer" (WISE) will die NASA ab Mitte Dezember den gesamten Himmel im Infrarotbereich untersuchen und dabei unbekannte und bislang unsichtbare Objekte im Weltall finden
Der Start von WISE wurde auf den 9. Dezember 2009 angesetzt und soll von der US- Air Force Basis Vandenberg in Kalifornien stattfinden. Kurz darauf soll das Infrarot-Himmelsauge dann die Erde entlang der Pole umkreisen und dabei den gesamten Himmel innerhalb von neun Monaten eineinhalb Mal abscannen.
Ziel der Mission ist es, bislang unentdeckte verborgene Himmelsobjekte, wie dunkle Asteroiden, Galaxien oder kalte Sterne finden. Bei letzteren handelt es sich um sich nicht vollends ausgebildete Sterne, sogenannte Braune Zwerge. Wissenschaftler vermuten, dass derartige Objekte zwischen riesigem Gasplanet und Stern sogar sehr viel näher und - obwohl bislang unentdeckt - direkt vor unseren Augen existieren könnten als der bislang dem Sonnensystem am nächsten gelegene Stern Proxima Centauri.
"Mit WISE werden wir Millionen von Objekten finden, wie wir sie bislang noch nie zuvor gesehen haben", zeigt sich der Chefuntersucher der Mission Edward Wright überzeugt und zugleich fasziniert von den Aussichten der Mission.
Das Teleskop wird den Himmel in vier Infraroten Wellenlängen mit einer Empfindlichkeit untersuchen, wie sie bisherige Instrumente um das bis zu Tausendfache übertreffen kann. Die gefundenen Objekte sollen umgehend erfasst und genau katalogisiert werden. Die hierbei gesammelten Daten sollen dann den Weg für nachfolgende Missionen ebnen, die dann die interessantesten der zu findenden Objekte genauer studieren sollen. Hierbei soll es dann auch zu gemeinsamen Missionen mit bereits vorhandenen Weltraumteleskopen wie Hubble, Spitzer, Herschel und den geplanten Teleskopen Sofia und James Webb kommen.
Der Start von WISE wurde auf den 9. Dezember 2009 angesetzt und soll von der US- Air Force Basis Vandenberg in Kalifornien stattfinden. Kurz darauf soll das Infrarot-Himmelsauge dann die Erde entlang der Pole umkreisen und dabei den gesamten Himmel innerhalb von neun Monaten eineinhalb Mal abscannen.
Ziel der Mission ist es, bislang unentdeckte verborgene Himmelsobjekte, wie dunkle Asteroiden, Galaxien oder kalte Sterne finden. Bei letzteren handelt es sich um sich nicht vollends ausgebildete Sterne, sogenannte Braune Zwerge. Wissenschaftler vermuten, dass derartige Objekte zwischen riesigem Gasplanet und Stern sogar sehr viel näher und - obwohl bislang unentdeckt - direkt vor unseren Augen existieren könnten als der bislang dem Sonnensystem am nächsten gelegene Stern Proxima Centauri.
"Mit WISE werden wir Millionen von Objekten finden, wie wir sie bislang noch nie zuvor gesehen haben", zeigt sich der Chefuntersucher der Mission Edward Wright überzeugt und zugleich fasziniert von den Aussichten der Mission.
Das Teleskop wird den Himmel in vier Infraroten Wellenlängen mit einer Empfindlichkeit untersuchen, wie sie bisherige Instrumente um das bis zu Tausendfache übertreffen kann. Die gefundenen Objekte sollen umgehend erfasst und genau katalogisiert werden. Die hierbei gesammelten Daten sollen dann den Weg für nachfolgende Missionen ebnen, die dann die interessantesten der zu findenden Objekte genauer studieren sollen. Hierbei soll es dann auch zu gemeinsamen Missionen mit bereits vorhandenen Weltraumteleskopen wie Hubble, Spitzer, Herschel und den geplanten Teleskopen Sofia und James Webb kommen.
Das Leben besteht nicht aus den Momenten, in denen wir atmen,
sondern aus denen, die uns den Atem rauben
Aus "Hitch- der Date Doctor"



sondern aus denen, die uns den Atem rauben
Aus "Hitch- der Date Doctor"
- Manu
- Beiträge: 25835
- Registriert: Di 25. Apr 2017, 14:13
- Wohnort: Schermbeck
- Kontaktdaten:
USA suchen mit einzigartigem Infrarot-Teleskop neue kosmische Objekte
Berlin/Vandenberg (ddp). Die US-Luft- und Raumfahrtbehörde NASA hat am Montag ein einzigartiges neues Infrarot-Teleskop ins All gestartet. Der «Wide-field Infrared Survey Explorer» (WISE) sei um 15.09 Uhr deutscher Zeit mit einer Delta II-Trägerrakete von der Luftwaffenbasis Vandenberg (Kalifornien) aufgestiegen, teilte die NASA mit. Er soll nach einer vierwöchigen Testphase die Erde neun Monate lang auf einer polaren Bahn in etwa 500 Kilometern Höhe umkreisen und dabei Millionen neuer kosmischer Objekte aufspüren. Ziel sei es, ein komplettes Bild des Universums im Infrarotbereich zu erstellen.
Im Vergleich zu bisherigen Teleskopen sucht das 670 Kilogramm schwere Gerät den Himmel in vier Infrarot-Wellenlängenbereichen mit einer hunderttausendfach größeren Lichtempfindlichkeit ab. Die Wissenschaftler versprechen sich davon die Entdeckung von neuen dunklen Asteroiden, Kometen, kalten Sternen und hell strahlenden Galaxien
Im Vergleich zu bisherigen Teleskopen sucht das 670 Kilogramm schwere Gerät den Himmel in vier Infrarot-Wellenlängenbereichen mit einer hunderttausendfach größeren Lichtempfindlichkeit ab. Die Wissenschaftler versprechen sich davon die Entdeckung von neuen dunklen Asteroiden, Kometen, kalten Sternen und hell strahlenden Galaxien
Das Leben besteht nicht aus den Momenten, in denen wir atmen,
sondern aus denen, die uns den Atem rauben
Aus "Hitch- der Date Doctor"



sondern aus denen, die uns den Atem rauben
Aus "Hitch- der Date Doctor"
- Manu
- Beiträge: 25835
- Registriert: Di 25. Apr 2017, 14:13
- Wohnort: Schermbeck
- Kontaktdaten:
Größtes Teleskop der Welt geht auf Galaxien-Jagd
Es wäre der Traum des Galileo Galilei: Knapp 400 Jahre, nachdem der Begründer der modernen Astronomie mit seinem Fernrohr die vier größten Jupiter-Monde entdeckte, geht am Freitag auf der Kanaren-Insel La Palma das derzeit größte Spiegelteleskop der Welt offiziell in Betrieb. Das Gran Telescopio Canarias (Grantecan) ist so stark wie vier Millionen menschliche Pupillen und so präzise, dass es einen Teller Linsen auf dem Mond erkennen oder, wenn die Erde eine Scheibe wäre, die Scheinwerfer eines fahrenden Autos in Australien auseinanderhalten könnte.
"Es ist wie ein Wunder", schwärmt Francisco Sánchez, der Direktor des Astrophysikalischen Instituts der Kanaren (IAC), welches das Vorhaben 1987 ins Leben rief. Vor zehn Jahren begannen dann die Bauarbeiten der rund 130 Millionen Euro teuren Anlage. Die Sternwarte steht in 2400 Metern Höhe auf dem Roque de los Muchachos, dem höchsten Gipfel der kleinen Kanaren-Insel.
Zu Beginn "große Skepsis"
"Es herrschte damals große Skepsis", erinnert sich Projektleiter Pedro Alvarez. "Und auch Angst, uns lächerlich zu machen", räumt er ein. Denn an ein so technologisch kompliziertes Unterfangen hatte sich Spanien zuvor nie herangewagt. Nun aber zählt das Land in diesem Bereich zur internationalen Elite.
Projektleiter Alvarez: Fremde Planeten entdecken
Mit dem Grantecan, auch als GTC bekannt, wollen die Wissenschaftler in bislang unerreichte Tiefen des Universums vorstoßen, fast bis zum Urknall vor rund 14 Milliarden Jahren. "Wir wollen sehr weit entfernte Galaxien und Planeten beobachten und die Entstehung der ersten Sterne studieren", sagte Chefastronom René Rutten. "Eine weitere Herausforderung ist die Beobachtung von Planeten jenseits unseres Sonnensystems, die als Exoplaneten bekannt sind", ergänzte der Niederländer. Alvarez geht noch weiter: "Es wäre natürlich wunderbar, wenn dieses Teleskop uns dabei helfen könnte, einen Planeten zu entdecken, der unserem ähnelt. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass es auch anderswo im Universum Leben geben kann."
"Kathedrale der Astronomie"
Das Herzstück dieses "Galaxien-Jägers" ist ein Spiegel von 10,4 Metern Durchmesser. Er besteht aus 36 Segmenten, wiegt rund 18 Tonnen und wurde vom Mainzer Technologiekonzern Schott gefertigt. Zur Positionierung des Riesenfernrohres kommen Winkel-Messgeräte der Firma Heidenhain aus dem bayerischen Traunreut zum Einsatz. Das Teleskop ist insgesamt etwa 400 Tonnen schwer - und lässt sich dennoch mühelos mit der Hand bewegen, da es auf einer dünnen Ölschicht "schwimmt". Die "Kathedrale der Astronomie", wie die imposante Konstruktion genannt wird, ist 45 Meter hoch. Das entspricht einem 14-stöckigen Hochhaus.
Spiegel hat eine Fläche von fast 82 Quadratmetern
Teleskope sind wie ein Trichter. Je größer der Spiegel, umso mehr Licht können sie einfangen. Mit einer nutzbaren Fläche von knapp 82 Quadratmetern ist der segmentierte Spiegel des Grantecan rund sechs Quadratmeter größer als der anderer Riesenteleskope - in der Astronomie sind das Welten. Um die Spiegelkrümmung auszugleichen, die beim Schwenken eines solchen Riesenfernrohrs angesichts des großen Eigengewichts entsteht, arbeitet die Anlage mit aktiver Optik: Die Spiegel sind auf sogenannten Aktoren gelagert, die die Krümmung ausgleichen. Andernfalls würden Abbildungsfehler entstehen - wie etwa das verzerrte Bild, das schlecht geschliffene Billigspiegel wiedergeben.
Adaptive Optik gleicht Lichtverzerrungen aus
Für glasklare Abbildungen soll auch die sogenannte adaptative Optik sorgen. Sie gleicht 200 Mal pro Sekunde die Verzerrungen des Lichts auf seinem Weg durch die Atmosphäre aus. Die Wirkung lässt sich mit einer Münze erklären, die in ein Schwimmbecken geworfen wurde: Bewegt sich das Wasser, ist sie kaum zu erkennen. Steht das Wasser dagegen still, ist sie leicht zu sehen.
Neues Riesenfernrohr auf Hawaii geplant
Riesenfernrohre gibt es bislang etwa auf dem Gipfel des erloschenen Vulkans Mauna Kea auf Hawaii (Keck I und Keck II), auf dem Mount Graham in Arizona (LBT) oder auf dem Cerro Paranal in Chile, wo die Europäische Südsternwarte das Very Large Telescope (VLT) betreibt. Diese Anlage verfügt über vier aus einem Stück gefertigte Spiegel mit einem Durchmesser von je 8,2 Metern, die auch zusammengeschaltet werden können. Als sogenanntes Einzelteleskop ist das Grantecan aber größer, betont Rutten. Allerdings soll auf dem Vulkan Mauna Kea auf Hawaii bis 2018 ein neues gewaltige Teleskop entstehen. Mit einem Spiegel von 30 Metern Durchmesser aus insgesamt 492 Einzelsegmenten wird dies dann das größte Teleskop der Welt sein.
Mehrere Sternwarten auf La Palma
Dessen Standort ist zudem in Europa einzigartig. Der klare Himmel über La Palma - geschützt durch ein Gesetz, das fremde Lichtquellen verbietet - und ein in der Regel gleichmäßig wehender Wind erleichtern die Arbeit der Sterngucker. Nicht umsonst gilt das Grantecan als bestes Instrument zur Erforschung des Himmels auf der Nordhalbkugel. Auf dem Gelände betreiben das IAC und andere Forschungszentren bereits mehrere Sternwarten. Finanziert wurde das Grantecan größtenteils von der spanischen und der kanarischen Regierung. Beteiligt sind zudem Universitäten aus Mexiko und USA.
"Es ist wie ein Wunder", schwärmt Francisco Sánchez, der Direktor des Astrophysikalischen Instituts der Kanaren (IAC), welches das Vorhaben 1987 ins Leben rief. Vor zehn Jahren begannen dann die Bauarbeiten der rund 130 Millionen Euro teuren Anlage. Die Sternwarte steht in 2400 Metern Höhe auf dem Roque de los Muchachos, dem höchsten Gipfel der kleinen Kanaren-Insel.
Zu Beginn "große Skepsis"
"Es herrschte damals große Skepsis", erinnert sich Projektleiter Pedro Alvarez. "Und auch Angst, uns lächerlich zu machen", räumt er ein. Denn an ein so technologisch kompliziertes Unterfangen hatte sich Spanien zuvor nie herangewagt. Nun aber zählt das Land in diesem Bereich zur internationalen Elite.
Projektleiter Alvarez: Fremde Planeten entdecken
Mit dem Grantecan, auch als GTC bekannt, wollen die Wissenschaftler in bislang unerreichte Tiefen des Universums vorstoßen, fast bis zum Urknall vor rund 14 Milliarden Jahren. "Wir wollen sehr weit entfernte Galaxien und Planeten beobachten und die Entstehung der ersten Sterne studieren", sagte Chefastronom René Rutten. "Eine weitere Herausforderung ist die Beobachtung von Planeten jenseits unseres Sonnensystems, die als Exoplaneten bekannt sind", ergänzte der Niederländer. Alvarez geht noch weiter: "Es wäre natürlich wunderbar, wenn dieses Teleskop uns dabei helfen könnte, einen Planeten zu entdecken, der unserem ähnelt. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass es auch anderswo im Universum Leben geben kann."
"Kathedrale der Astronomie"
Das Herzstück dieses "Galaxien-Jägers" ist ein Spiegel von 10,4 Metern Durchmesser. Er besteht aus 36 Segmenten, wiegt rund 18 Tonnen und wurde vom Mainzer Technologiekonzern Schott gefertigt. Zur Positionierung des Riesenfernrohres kommen Winkel-Messgeräte der Firma Heidenhain aus dem bayerischen Traunreut zum Einsatz. Das Teleskop ist insgesamt etwa 400 Tonnen schwer - und lässt sich dennoch mühelos mit der Hand bewegen, da es auf einer dünnen Ölschicht "schwimmt". Die "Kathedrale der Astronomie", wie die imposante Konstruktion genannt wird, ist 45 Meter hoch. Das entspricht einem 14-stöckigen Hochhaus.
Spiegel hat eine Fläche von fast 82 Quadratmetern
Teleskope sind wie ein Trichter. Je größer der Spiegel, umso mehr Licht können sie einfangen. Mit einer nutzbaren Fläche von knapp 82 Quadratmetern ist der segmentierte Spiegel des Grantecan rund sechs Quadratmeter größer als der anderer Riesenteleskope - in der Astronomie sind das Welten. Um die Spiegelkrümmung auszugleichen, die beim Schwenken eines solchen Riesenfernrohrs angesichts des großen Eigengewichts entsteht, arbeitet die Anlage mit aktiver Optik: Die Spiegel sind auf sogenannten Aktoren gelagert, die die Krümmung ausgleichen. Andernfalls würden Abbildungsfehler entstehen - wie etwa das verzerrte Bild, das schlecht geschliffene Billigspiegel wiedergeben.
Adaptive Optik gleicht Lichtverzerrungen aus
Für glasklare Abbildungen soll auch die sogenannte adaptative Optik sorgen. Sie gleicht 200 Mal pro Sekunde die Verzerrungen des Lichts auf seinem Weg durch die Atmosphäre aus. Die Wirkung lässt sich mit einer Münze erklären, die in ein Schwimmbecken geworfen wurde: Bewegt sich das Wasser, ist sie kaum zu erkennen. Steht das Wasser dagegen still, ist sie leicht zu sehen.
Neues Riesenfernrohr auf Hawaii geplant
Riesenfernrohre gibt es bislang etwa auf dem Gipfel des erloschenen Vulkans Mauna Kea auf Hawaii (Keck I und Keck II), auf dem Mount Graham in Arizona (LBT) oder auf dem Cerro Paranal in Chile, wo die Europäische Südsternwarte das Very Large Telescope (VLT) betreibt. Diese Anlage verfügt über vier aus einem Stück gefertigte Spiegel mit einem Durchmesser von je 8,2 Metern, die auch zusammengeschaltet werden können. Als sogenanntes Einzelteleskop ist das Grantecan aber größer, betont Rutten. Allerdings soll auf dem Vulkan Mauna Kea auf Hawaii bis 2018 ein neues gewaltige Teleskop entstehen. Mit einem Spiegel von 30 Metern Durchmesser aus insgesamt 492 Einzelsegmenten wird dies dann das größte Teleskop der Welt sein.
Mehrere Sternwarten auf La Palma
Dessen Standort ist zudem in Europa einzigartig. Der klare Himmel über La Palma - geschützt durch ein Gesetz, das fremde Lichtquellen verbietet - und ein in der Regel gleichmäßig wehender Wind erleichtern die Arbeit der Sterngucker. Nicht umsonst gilt das Grantecan als bestes Instrument zur Erforschung des Himmels auf der Nordhalbkugel. Auf dem Gelände betreiben das IAC und andere Forschungszentren bereits mehrere Sternwarten. Finanziert wurde das Grantecan größtenteils von der spanischen und der kanarischen Regierung. Beteiligt sind zudem Universitäten aus Mexiko und USA.
Das Leben besteht nicht aus den Momenten, in denen wir atmen,
sondern aus denen, die uns den Atem rauben
Aus "Hitch- der Date Doctor"



sondern aus denen, die uns den Atem rauben
Aus "Hitch- der Date Doctor"
- Manu
- Beiträge: 25835
- Registriert: Di 25. Apr 2017, 14:13
- Wohnort: Schermbeck
- Kontaktdaten:
Europäer bauen weltgrößtes Teleskop in Chile
Antofagasta/ Chile - Die "Europäische Südsternwarte" (ESO) hat entschieden: Mit dem "European Extremely Large Telescope" (E-ELT) soll auf dem chilenischen 3.060 Meter hohen Cerro Armazones bis 2018 das größte Teleskop der Welt entstehen. Mit einer Spiegelfläche von 42 Metern soll das E-ELT schlussendlich die 15fache Auflösung des Weltraumteleskops Hubble erreichen und gänzlich neue Einblicke ins Universum ermöglichen.
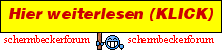
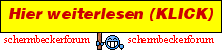
Das Leben besteht nicht aus den Momenten, in denen wir atmen,
sondern aus denen, die uns den Atem rauben
Aus "Hitch- der Date Doctor"



sondern aus denen, die uns den Atem rauben
Aus "Hitch- der Date Doctor"
- Manu
- Beiträge: 25835
- Registriert: Di 25. Apr 2017, 14:13
- Wohnort: Schermbeck
- Kontaktdaten:
Kostenexplosion verzögert Hubble-Nachfolger
Washington/ USA - Eine Arbeitsgruppe der NASA hat gravierende Fehlkalkulationen bei dem ursprünglich für 2013, dann für 2014 geplanten "James Webb Space Telescope" ausgemacht, wie sie den Start des Weltraumteleskops und Hubble-Nachfolgers um 15 Monate oder sogar noch deutlich länger verzögern könnten. Mit dem bislang größten Weltraumteleskop könnten Astronomen auch Exoplaneten besser direkt erforschen als je zuvor und damit auch Kandidaten für möglicherweise bewohnte fremde Welten ins Visier nehmen.
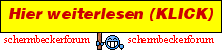
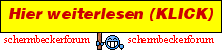
Das Leben besteht nicht aus den Momenten, in denen wir atmen,
sondern aus denen, die uns den Atem rauben
Aus "Hitch- der Date Doctor"



sondern aus denen, die uns den Atem rauben
Aus "Hitch- der Date Doctor"
- Manu
- Beiträge: 25835
- Registriert: Di 25. Apr 2017, 14:13
- Wohnort: Schermbeck
- Kontaktdaten:
Astronomen rätseln / Teleskop Chandra
Pasadena/ USA - Seit den 1980er Jahren haben Astronomen 13 Radiosignale aus eigentlich leeren Regionen des Universums aufgefangen und rätseln seither über deren Ursprung. Ein neuer Ansatz glaubt nun, dass sie von schon vor langer Zeit erloschenen Sternen stammen
Bei den Radiosignalen könnte es sich um Spuren längst vergangener Galaxien und Sterne, sogenannte Neutronensterne handeln, die - meist unbemerkt das Universum durchziehen. Das glaubt zumindest ein Team von Astrophysikern um Eran Ofek vom California Institute of Technology (Caltech). Die meisten der rund eine Milliarde geschätzter Neutronensterne, sind nahezu unsichtbar. Einige verraten sich jedoch durch die extrem hohe Rotation, wobei Radiopulse mehrmals pro Sekunde auch in Richtung Erde ausgeschleudert werden. Je älter die Neutronensterne jedoch werden, desto langsamer wird jedoch auch deren Rotation.
Wenn nun ein Neutronenstern im Abstand von mehreren Monaten Radioausbrüche produziert, wenn er beispielsweise interstellare Gase absorbiert, könnten diese Ausbrüche relativ erdnaher Neutronensterne auch von der Erde aus wahrgenommen werden.
"Neutronensterne sind ein guter Ansatz, die Radiosignale zu erklären", zitiert der "New Scientist" den Astronomen Geoffrey Bower von der University of California in Berkeley, der alleine sieben der unbekannten Signale entdeckt hat.
Schon bald wollen die Forscher die Ursprungsregionen der Signale mit dem Röntgenobservatorium Chandra auf die für Neutronensterne charakteristische Röntgenstrahlung absuchen, um so ihre Theorie zu überprüfen
Bei den Radiosignalen könnte es sich um Spuren längst vergangener Galaxien und Sterne, sogenannte Neutronensterne handeln, die - meist unbemerkt das Universum durchziehen. Das glaubt zumindest ein Team von Astrophysikern um Eran Ofek vom California Institute of Technology (Caltech). Die meisten der rund eine Milliarde geschätzter Neutronensterne, sind nahezu unsichtbar. Einige verraten sich jedoch durch die extrem hohe Rotation, wobei Radiopulse mehrmals pro Sekunde auch in Richtung Erde ausgeschleudert werden. Je älter die Neutronensterne jedoch werden, desto langsamer wird jedoch auch deren Rotation.
Wenn nun ein Neutronenstern im Abstand von mehreren Monaten Radioausbrüche produziert, wenn er beispielsweise interstellare Gase absorbiert, könnten diese Ausbrüche relativ erdnaher Neutronensterne auch von der Erde aus wahrgenommen werden.
"Neutronensterne sind ein guter Ansatz, die Radiosignale zu erklären", zitiert der "New Scientist" den Astronomen Geoffrey Bower von der University of California in Berkeley, der alleine sieben der unbekannten Signale entdeckt hat.
Schon bald wollen die Forscher die Ursprungsregionen der Signale mit dem Röntgenobservatorium Chandra auf die für Neutronensterne charakteristische Röntgenstrahlung absuchen, um so ihre Theorie zu überprüfen
Das Leben besteht nicht aus den Momenten, in denen wir atmen,
sondern aus denen, die uns den Atem rauben
Aus "Hitch- der Date Doctor"



sondern aus denen, die uns den Atem rauben
Aus "Hitch- der Date Doctor"
- Manu
- Beiträge: 25835
- Registriert: Di 25. Apr 2017, 14:13
- Wohnort: Schermbeck
- Kontaktdaten:
Chandra entdeckt jüngstes nahes Schwarzes Loch
Cambridge/ USA - Seit der Ankündigung der Entdeckung eines "ungewöhnliches Objekt in unserer kosmischen Nachbarschaft" wurde besonders im Internet hitzig darüber spekuliert, um was für ein Objekt es sich dabei handeln könnte. Auf der angekündigten Pressekonferenz haben NASA-Astronomen das Geheimnis nun gelüftet: Mit dem Weltraumteleskop "Chandra" haben sie Beweise für das bislang jüngste Schwarze Loch in unserer "kosmischen Nachbarschaft" gefunden. Gerade einmal 30 Jahre alt, bietet das junge Schwarze Loch nun ideale Bedingungen der Beobachtung der Entwicklung derart junger Schwarzer Löcher.
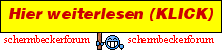
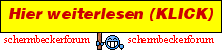
Das Leben besteht nicht aus den Momenten, in denen wir atmen,
sondern aus denen, die uns den Atem rauben
Aus "Hitch- der Date Doctor"



sondern aus denen, die uns den Atem rauben
Aus "Hitch- der Date Doctor"
- Manu
- Beiträge: 25835
- Registriert: Di 25. Apr 2017, 14:13
- Wohnort: Schermbeck
- Kontaktdaten:
Mysteriöse Gamma-Blitze in der Atmosphäre
Greenbelt/ USA - Normalerweise ereignen sich hochenergetische Ausbrüche von Gammastrahlung nur weit von der Erde entfernt im All, beispielsweise in der Nähe von Schwarzen Löchern oder anderen hochenergetischen kosmischen Phänomenen. Mitte der 1990er Jahr entdeckten Wissenschaftler ähnliche Ereignisse jedoch auch in der Atmosphäre der Erde und rätseln seither, wie es zu diesen Erscheinungen überhaupt kommt. Ein Satellit soll nun das Mysterium enträtseln und erklären, was auch gewöhnliche Blitze auslöst
Bisherige Beobachtungen der sogenannten "Terrestrial Gamma-ray Flashes" (TGFs= irdische Gammastrahlen-Blitze) legen die Vermutung nahe, dass sie mit normalen Blitzen in Verbindung stehen, auch wenn TGFs selbst von gänzlich anderer Natur sind.
"Tatsächlich wusste vor den 1990er Jahren noch niemand, dass diese Phänomene überhaupt existierten", gesteht Doug Rowland vom "Goddard Space Flight Center" der NASA. "Obwohl es sich um die gewaltigsten natürlichen partikelbeschleunigenden Ereignisse auf der Erde handelt."
Einzelne Partikel in einem TGF benötigen enorme Mengen von Energie, die teilweise über 20 Mega Elektronenvolt (M eV). Im Gegensatz dazu entfesseln die farbenfrohen Polarlichter lediglich ein Tausendstel dieser Energiemenge.
Bislang gibt es rund um die TGFs mehr Fragen als Antworten: Was lässt die Gammastrahlenblitze überhaupt entstehen? Helfen sie dabei, gewöhnliche Blitze auszulösen und könnten sie für hochenergetische Partikel im Van-Allen- Strahlungsgürtel verantwortlich sein, wie die Satelliten beschädigen können.
Mit einem kaum mehr als fußballgroßen Satelliten (s. Abb.) namens "Firefly" (Glühwürmchen) sollen sowohl Daten gewöhnlicher Blitze als auch über die für das menschliche Auge unsichtbaren TGFs gewonnen und dann miteinander abgeglichen werden.
Von den Daten erhoffen sich die Forscher auch Antworten zu der immer noch unbeantworteten Frage, wodurch gewöhnliche Blitze überhaupt ausgelöst werden. Zwar ist bekannt, dass Turbulenzen im Innern von Gewitterwolken elektrische Ladungen bis hin zu gigantischen elektrischen Potentialen erzeugen. Die jedoch zur Ionisation der Luft tatsächlich benötige Spannung ist etwa zehnmal Höher als die Spannungspotentiale, wie sie im Innern der Wolken gemessen werden können. "Wir wissen zwar, wie sich die Wolken aufladen. Wir wissen aber nicht, wie sie sich wieder entladen. Dieser Vorgang ist immer noch ein Mysterium", kommentiert Rowland.
Die TGFs könnten nun diese Spannung zur Entladung der Gewitterwolken liefern, in dem sie einen kurzen und Ausstoß von Elektronen abgeben und dadurch die Blitze auslösen.
Wenn diese Vermutung der Forscher zutrifft, würde dies zugleich bedeuten, dass es jeden Tag wesentlich mehr TGFs gibt als derzeit bekannt. Bislang gehen die Wissenschaftler weltweit von weniger als 100 irdischen Gammablitzen pro Tag aus, während es tagtäglich global zu mehren Millionen gewöhnlicher Blitze kommt.
Bisherige Beobachtungen der sogenannten "Terrestrial Gamma-ray Flashes" (TGFs= irdische Gammastrahlen-Blitze) legen die Vermutung nahe, dass sie mit normalen Blitzen in Verbindung stehen, auch wenn TGFs selbst von gänzlich anderer Natur sind.
"Tatsächlich wusste vor den 1990er Jahren noch niemand, dass diese Phänomene überhaupt existierten", gesteht Doug Rowland vom "Goddard Space Flight Center" der NASA. "Obwohl es sich um die gewaltigsten natürlichen partikelbeschleunigenden Ereignisse auf der Erde handelt."
Einzelne Partikel in einem TGF benötigen enorme Mengen von Energie, die teilweise über 20 Mega Elektronenvolt (M eV). Im Gegensatz dazu entfesseln die farbenfrohen Polarlichter lediglich ein Tausendstel dieser Energiemenge.
Bislang gibt es rund um die TGFs mehr Fragen als Antworten: Was lässt die Gammastrahlenblitze überhaupt entstehen? Helfen sie dabei, gewöhnliche Blitze auszulösen und könnten sie für hochenergetische Partikel im Van-Allen- Strahlungsgürtel verantwortlich sein, wie die Satelliten beschädigen können.
Mit einem kaum mehr als fußballgroßen Satelliten (s. Abb.) namens "Firefly" (Glühwürmchen) sollen sowohl Daten gewöhnlicher Blitze als auch über die für das menschliche Auge unsichtbaren TGFs gewonnen und dann miteinander abgeglichen werden.
Von den Daten erhoffen sich die Forscher auch Antworten zu der immer noch unbeantworteten Frage, wodurch gewöhnliche Blitze überhaupt ausgelöst werden. Zwar ist bekannt, dass Turbulenzen im Innern von Gewitterwolken elektrische Ladungen bis hin zu gigantischen elektrischen Potentialen erzeugen. Die jedoch zur Ionisation der Luft tatsächlich benötige Spannung ist etwa zehnmal Höher als die Spannungspotentiale, wie sie im Innern der Wolken gemessen werden können. "Wir wissen zwar, wie sich die Wolken aufladen. Wir wissen aber nicht, wie sie sich wieder entladen. Dieser Vorgang ist immer noch ein Mysterium", kommentiert Rowland.
Die TGFs könnten nun diese Spannung zur Entladung der Gewitterwolken liefern, in dem sie einen kurzen und Ausstoß von Elektronen abgeben und dadurch die Blitze auslösen.
Wenn diese Vermutung der Forscher zutrifft, würde dies zugleich bedeuten, dass es jeden Tag wesentlich mehr TGFs gibt als derzeit bekannt. Bislang gehen die Wissenschaftler weltweit von weniger als 100 irdischen Gammablitzen pro Tag aus, während es tagtäglich global zu mehren Millionen gewöhnlicher Blitze kommt.
Das Leben besteht nicht aus den Momenten, in denen wir atmen,
sondern aus denen, die uns den Atem rauben
Aus "Hitch- der Date Doctor"



sondern aus denen, die uns den Atem rauben
Aus "Hitch- der Date Doctor"
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast