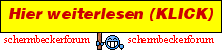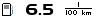Adolf Klammer ist „Bergmann mit Leib und Seele“. Im Ruhestand hat er sich sogar ein eigenes Schachtmodell gebaut. Zum Aus der Zechen sagt er: „Wenn die Räder stillstehen, das tut einem weh.“
Dass Adolf Klammer (81) Bergmann werden würde, war früh klar: Schon sein Vater war Bergmann. Klammer: „Kennen Sie das Grubenunglück von Lengede? Den Schacht hat mein Vater mitgeteuft.“ Teufen nennt der Bergmann die Herstellung von Schächten.

Sein Wissen konnte Adolf Klammers Vater nicht mehr an ihn weitergeben - er fiel im Krieg. Zu diesem Zeitpunkt war Adolf Klammers Mutter mit fünf Kindern unter zehn Jahren auf sich gestellt. Der älteste Bruder von Adolf Klammer starb 1947 an einer Blinddarmentzündung, die Mutter half in Bodenstein am Harz auf den Feldern mit, um die Familie durchzubringen.
„Es war ja sonst nichts.“
Im Ruhrgebiet wurden damals dringend Bergleute gesucht. Zwei, drei Leute der Hibernia AG seien damals in die Schule gekommen, hätten mit Eltern geredet, die Jungs der achten Klasse „ein bisschen untersucht, ob man tauglich ist“. Die Berufsaussichten waren ansonsten mau: „Wenn man Glück hatte, konnte man Maurer werden - es war ja sonst nichts“, erinnert sich Adolf Klammer.
Sein zwei Jahre älterer Bruder war bereits 1950 zur Schachtanlage Hibernia in Gladbeck in die Ausbildung gegangen. Als 14-Jähriger zog er ins Lehrlingsheim in Gladbeck-Zweckel. Adolf Klammer folgte ihm zwei Jahre später als 14-Jähriger und startete am 8. April 1952 seine Lehre.

Seinen Lehrvertrag hat Adolf Klammer immer noch aufgehoben. © Berthold Fehmer
Getrennt von ihrer Familie waren alle Jungs, die damals im Lehrlingsheim wohnten. „Die Jungs haben da gesessen und geheult. Die haben Heimweh gehabt“, sagt Adolf Klammer über diese harte Zeit. Mithilfe des Bergbaus gelang es beiden Jungs, eine Wohnung zu bekommen und die Mutter und zwei Schwestern nach Gladbeck zu holen. „Im Grunde sind wir da wieder eine Familie geworden.“

Adolf Klammer als Lehrjunge © Berthold Fehmer
Als Lehrjunge durfte Klammer erst mit 16 Jahren untertage. „Vorher wurde übertage alles durchgezogen“, sagt Klammer. Er lernte schweißen, Motoren zu reparieren, Holzarbeiten. An die erste Grubenfahrt am 2. November 1953 kann sich Klammer noch gut erinnern. „Da hat man drauf gewartet, gezittert, dass es endlich losgeht.“ Klammer sah, wie das letzte Pferd, das untertage arbeitete, feierlich aus der Grube entlassen und in Rente geschickt wurde.
Ein Schacht war für die Lehrlinge reserviert
Zunächst durften die Lehrlinge aber nur in einem Schacht arbeiten, der für sie reserviert war. Dort lernten sie Stempel stellen oder wie man die Förderbänder in Betrieb hält.

Der Knappenbrief, den Adolf Klammer nach seiner Ausbildung erhielt. © Berthold Fehmer
Als Jungbergmann mit Knappenbrief besserte Adolf Klammer Strecken aus, „wenn was eingebrochen war“. Als Jungbergmann habe man als „noch nicht voll arbeitsfähig“ gegolten und deshalb bis zum Alter von 20 Jahren fünf Prozent vom Lohn abgezogen bekommen, sagt Klammer. Der Grund dafür, weshalb er schnellstmöglich seinen Hauerbrief absolviert habe, um auf den vollen Lohn zu kommen.
Die Strecke von Zweckel nach Scholven, damals noch ein Werk, half Adolf Klammer voranzutreiben. „650 Meter etwa“. „Im Grunde war ich nie an der Kohle, sondern nur in Vorrichtungsarbeiten.“ Klammer trieb die Schächte waagerecht und senkrecht durchs Gestein, in denen die anderen später die Kohle förderten.

Ein Bild von der Schachtanlage Zweckel hat Adolf Klammer bei sich aufgehängt. © Berthold Fehmer
Das Zechensterben im Ruhrgebiet, das Ende dieses Jahres in Bottrop-Kirchhellen seinen Abschluss findet, hat Klammer von Beginn an miterlebt. „Zweckel gehörte mit zu den ersten Schachtanlagen, die im Ruhrgebiet zugemacht wurden.“ 1961 war das.
Stimmung unter Bergleuten „enorm schlecht“
„Enorm schlecht“ sei damals die Stimmung unter den Bergleuten gewesen, erinnert sich Klammer. „Das war wie ein Familienbetrieb, da kannte jeder jeden.“ 600 bis 700 Bergleute seien es insgesamt in Zweckel zu der Zeit gewesen, „eine Kameradschaft, da hat sich der eine auf den anderen verlassen. Man kannte die Familien, die Kinder.“ Den Bergleuten sei klar gewesen, dass die Zeiten nicht besser würden. „Es stand jeden Tag in der Zeitung, dass das Bergwerk Geld kriegt, damit es existieren kann.“
Klammers Trupp wechselte nach Bottrop
Während die anderen Bergmänner zur Zeche Bergmannsglück in Gelsenkirchen-Hassel gingen, wechselte der Trupp, in dem Klammer mit 25 anderen Männern arbeitete, zur Zeche Prosper in Bottrop. Genauer gesagt zur Firma Brenner, einer Firma aus der Eifel, die eigentlich Schiefer förderte. Für Prosper trieb die Firma Strecken durchs Gestein. Acht Jahre arbeitete Klammer in Bottrop, später auf der Zeche Concordia in Oberhausen. Auch die schloss 1968.

Adolf Klammer (l.) in Oberhausen-Sterkrade auf einem der Grubenräder, mit denen sich die Bergleute untertage fortbewegten. "Wenn der Zug kam, musste man die Räder von den Schienen nehmen." © Berthold Fehmer
„Es wird immer schlimmer“, das sei allen Bergleuten zu dieser Zeit klar gewesen, sagt Klammer, der vorsorglich den Führerschein Klasse 2 für Lkw gemacht hatte. Das erwies sich als Glücksfall, denn als er mit seinen Kumpels frustriert und wütend in der Kneipe saß, erhielten sie vom Wirt den Tipp, es bei einer Stahlbaufirma in Dinslaken zu versuchen. „Neun Jahre war ich dort Autokranfahrer, ganz weg vom Bergbau.“ Doch dann schloss auch diese Firma.
Uranbergbau in Kanada
An Angeboten hat es Klammer in seinem Leben nie gemangelt. Ganz kurz habe er einmal davor gestanden, Uranbergbau in Kanada zu betreiben. Auch beim Bau des Flughafens in Mekka waren seine Dienste erwünscht. Aufgrund der familiären Situation entschied er sich dagegen. Klammer ging zu „Gebhardt & Koenig“ und arbeitete auf Nordstern in Gelsenkirchen, wieder in der Vorrichtung, für zwei Jahre. Anschließend in Neukirchen-Vluyn, wo er eine neue Schachtstrecke ausbaute.
Klammer erlebte auch die Akademisierung im Bergbau mit. „Wenn da wieder ein paar Doktoren zu Besuch angekündigt wurden, haben wir immer gesagt: Ist hier irgendwo ein Ärzte-Kongress?“ Zum Sprengbeauftragten („Schießmann“) ließ sich Klammer in Niederberg ausbilden, diese Aufgabe übernahm er bis zum Vorruhestand im Jahr 1993.
1995 zog Klammer nach Schermbeck. Der Bergbau hat ihn aber nie losgelassen. „Er ist Bergmann mit Leib und Seele“, sagt seine Frau Erna, mit der Klammer zwei Kinder hat. „Meine Frau sagt, ich bin verrückt“, sagt Adolf Klammer grinsend. Denn er hat sich an seinem Häuschen auf einem Campingplatz kurz hinter der Schermbecker Grenze in Hünxe einen kleinen Modellschacht gebaut.

Die Bergmannsbegrüßung "Glück Auf" darf am Schachtmodell nicht fehlen. © Berthold Fehmer
Das Modell strotzt nur so vor kleinen Details. Klammer hat eine Beleuchtung eingebaut, die über Solarzellen auf dem Dach des Häuschens betrieben wird. „Im Sommer sind wir immer hier“, sagt Klammer stolz über sein Refugium, das einen tollen Ausblick auf den Wesel-Datteln-Kanal bietet. Sogar Schläuche zur Belüftung des Schachts hat Klammer eingebaut:

Schläuche sorgen im Schacht für Belüftung, auch Hammer und Lore fehlen nicht. Im Inneren ist sogar eine Beleuchtung eingebaut. © Berthold Fehmer
Und für den Abtransport des Materials hat Klammer ein paar Spielzeug-Fahrzeuge abgestellt:

Was die Faszination des Bergbaus für ihn genau ausmacht? Klammer überlegt lange. So richtig könne er das nicht erklären. „Es ging als Jugendlicher um viel Geld“, sagt er. Und: „Man bekam viel Unterstützung von der Zeche.“ Etwa, als er mit seiner späteren Frau eine Wohnung gesucht habe.
„Ich würde immer wieder reinfahren“, sagt Adolf Klammer, der im Netzwerk Schermbeck Fahrten zum Bergbaumuseum in Bochum anbietet. Etwa wieder am 27. Oktober (Samstag). Nur den normalen Schnupftabak, den die anderen Bergleute bei den „Prisenpausen“ nahmen, mochte Klammer nicht. „Ein Kumpel hat sogar den Tabak aus der Pfeife gekaut.“ Klammer hielt sich an den weißen Schnupftabak, auch „Schnee“ genannt. „Schnupftabak - das gehörte zum Bergmann dazu“